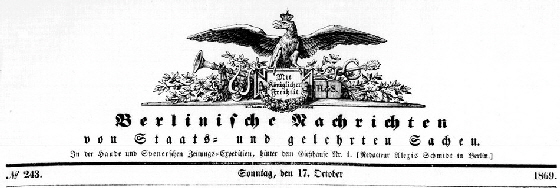|
|
 |
 |
|
Der Angelpunkt des Konzils
|
 |
 |
|
 |
|
 |
|
|
|
“So viel steht geschichtlich fest: einen Primat des Petrus über die andern Apostel in dem Sinne, wie ihn das Papsttum heut in Anspruch nimmt, hat es nie gegeben, Petrus konnte ihn also auch einem Nachfolger nicht übertragen.”
Rom, 11. Mai 1870. [Der Angelpunkt des Concils.] Trotz der Bemühungen um stricte Geheimhaltung ist hier die Constitutio de Ecclesia Christi bekannt geworden, welche gestern an die Concilsväter verteilt wurde. Dieses Actenstück, in dogmatischer wie in politischer Hinsicht von der größten Wichtigkeit, bildet den Angelpunkt des gesamten Concils, um welchen sich das Episcopat der katholischen Kirche in zwei unversöhnlich feindliche Lager gespalten hat. Nachfolgend die wichtigsten Punkte daraus:
Canon I. So Jemand sagt, der heil. Apostel Petrus sei nicht als Fürst aller Apostel und als sichtbares Haupt der gesamten streitenden Kirche von Christus dem Herrn bestellt; oder derselbe habe nur den Primat der Ehre, nicht aber den der wahren und besonderen Jurisdiction von dem Herrn direct und unmittelbar erhalten – der sei verflucht.
Canon II. So Jemand sagt, der heilige Petrus habe nicht in Folge der Einsetzung Christi selbst fortdauernde Nachfolger im Primat über die ganze Kirche; der Römische Pontifex sei nicht kraft göttlichen Rechts der Nachfolger Petri in diesem Primat – der sei verflucht.
Canon III. So Jemand sagt, der Römische Pontifex habe nur das Amt der Aufsicht oder Leitung, nicht aber die volle und höchste Jurisdictions-Gewalt für die gesamte Kirche, nicht allein in Sachen des Glaubens und der Moral, sondern auch der Disciplin und des Regiments der über die ganze Erde ausgebreiteten Kirche; oder diese seine Gewalt sei nicht die geordnete und unmittelbare über alle und jedwede Kirchen oder über alle und jedwede Hirten und Gläubige – der sei verflucht.
Canon IV. So Jemand sagt, der Römische Papst könne irren, wenn er, als höchster Lehrer aller Christen auftretend, mit seiner apostolischen Autorität definiert, was in Sachen des Glaubens und der Moral von der ganzen Kirche zu befolgen, sowie was als dem Glauben zuwider zu verwerfen sei; oder, es seien solche Decrete oder Urteilssprüche nicht unabänderlich, und nicht von jedem Christen, sobald sie ihm kund geworden, mit dem vollen Gehorsam des Glaubens anzunehmen und zu halten – der sei verflucht.
Rom, 20. Mai 1870. [Der fehlbare Petrus und seine unfehlbaren Nachfolger.] So viel steht geschichtlich fest: einen Primat des Petrus über die andern Apostel in dem Sinne, wie ihn das Papsttum heut in Anspruch nimmt, hat es nie gegeben, Petrus konnte ihn also auch einem Nachfolger nicht übertragen. Nur wenn das "Babylon" im ersten Petrusbrief wirklich als Rom zu verstehen ist, enthält das Neue Testament die Spur eines Hinweises, dass er jemals in Rom war. Dass er dort Bischofswürde bekleidete, ist durch kein Document, keinen Brief von Petrus oder einem anderen Apostel belegt (und neben ihm hätte ja auch Paulus in Rom gelebt). Erst recht ist es pure Erfindung, dass er die Bischofswürde einem Nachfolger übertragen hätte. Und dass dies mit so weitreichenden Vollmachten geschehen, wie sie die römischen Päpste für sich reclamieren, darüber existiert kein Document, noch irgend ein Beweis, sind doch die Quellen selbst über denjenigen verschiedener Meinung, der (wenn denn Petrus wirklich der erste gewesen wäre) nach ihm Bischof in Rom gewesen. Irenaeus und Eusebius nennen Linus, andre Väter aber Clemens als den ersten römischen Bischof. Und der dritte römische Bischof Clemens weiß nichts davon, dass Petrus sein Vorgänger gewesen sei; vielmehr verherrlicht er den Paulus. Im übrigen ist die Vorstellung, dass sich etwa der in Kleinasien wirkende Apostel Johannes dem Linus oder einem sonstigen Nachfolger des Petrus untergeordnet hätte, geradezu abgeschmackt.
Und wie geht man in Rom mit den Zweifeln um, die sich jedem denkenden Menschen bei solch kümmerlichen Beweisen einstellen müssen? Nun: man könnte beispielsweise darum beten, Gott möge das Wirken des Papstes so segensreich machen, dass jedermann das göttliche Walten von selbst erkenne. Offenbar glaubt aber in Rom selber niemand an das Segensreiche im eigenen Handeln, und so wirft man statt dessen mit Drohungen und Verfluchungen um sich. Wer nicht glaubt, dass Petrus den Primat vor allen Aposteln hatte – verflucht! Wer nicht glaubt, dass er den Primat an Nachfolger weitergab – verflucht! Wer nicht glaubt, dass dem römischen Papst der Wille Gottes offenbar sei – verflucht! Uns scheint sich in solchem Gefluche weniger das Wirken des Heiligen Geistes zu offenbaren, als vielmehr der Geist und die Redeweise von üblem Straßengesindel.
Augsburg, 25. Mai 1870. [Botschaft an Antonelli.] Die "A. A. Z." veröffentlicht den Text des vertraulichen Schreibens, welches v. Arnim als Gesandter Preußens und des Norddeutschen Bundes zur Unterstützung der französischen Vorstellungen im April an den Heiligen Stuhl sandte. Hierin heißt es:
"Monseigneur! Die kaiserlich französische Regierung hat uns von dem auf das Concil bezüglichen Memorandum Kenntnis gegeben, welches Se. Heiligkeit aus den Händen des französischen Botschafters entgegenzunehmen geruht hat.
Die Regierung des Norddeutschen Bundes, Zeugin der tiefen Bewegung, welche im Schoße der Kirche in Deutschland herrscht, würde ihre Pflicht versäumen, wenn sie nicht die Identität der in dem französischen Actenstück entwickelten Ansichten mit den ernsten Besorgnissen bestätigte, die sich in Deutschland der Geister bemächtigt haben, welche erschrocken sind bei der Idee, dass Concilsbeschlüsse, die der beinahe einmütigen Ansicht des deutschen Episcopats zum Trotz gefaßt würden, peinliche Lagen schaffen könnten, indem sie den Gewissen Kämpfe ohne Ende auferlegten."
Bekanntlich hat aber auch diese Mahnung nichts gefruchtet. Es hat ganz den Anschein, als wäre in den Köpfen des Papstes und seiner Ratgeber ein geradezu diabolisches Bestreben am Werke, welches es darauf anlegt, der Kirche genau die Probleme zu verschaffen, vor denen sie von allen Seiten gewarnt wird.
Rom, 4. Juni 1870. [Unerwarteter Schluss der General-Debatte zur Unfehlbarkeit.] Der "Pr." wird geschrieben:
Die Sitzung hob ruhig an und nichts deutete auf eine plötzliche Veränderung hin. Einige Bischöfe, darunter Moriarty und Dinkel, sprachen sich ruhig, aber bestimmt gegen die Unfehlbarkeit aus. Danach sprach Maret, Bischof von Sura, und zwar wie seine Vorredner gegen die Infallibilität, jedoch mit äußerst heftigen Worten. Je länger er sprach, desto mehr stieg die Unruhe und Gereiztheit auf Seiten der Majorität, es ging ein dumpfes Gemurre durch die Reihen der Dogmafreunde. Was weiter folgte, wirkte wie ein Blitz aus heiterem Himmel: an die 150 Väter verlangten wie Ein Mann Schluss der Debatte. Ungeheuerste Überraschung und Aufregung! Die Väter verließen ihre Sitze und bildeten Gruppen um einflussreiche Sprecher und Führer; in allen Sprachen wogte es durcheinander. Selbst auf der Präsidentenbank ging es lebhaft zu; offenbar war man sich keineswegs einig. Wird der Antrag zur Abstimmung gebracht? Man glaubt, dass die Legaten in ihrer Verlegenheit möglichst unauffällig einen Vertrauensmann zum Heiligen Vater oder zu Antonelli hinaufgeschickt, um sich für diesen unerwarteten, höchst wichtigen Incidenzfall Rat zu erbitten. Endlich ertönt die Glocke. Große Erwartung auf allen Gesichtern! Die Legaten haben beschlossen, über den Antrag der 150 zur Abstimmung zur schreiten. Doch das ist nicht so leicht; denn von Neuem fluten die Ausrufe und Äußerungen durcheinander; die Gruppen wollen sich nicht auflösen, um die verwaisten Bänke zu besetzen, namentlich auf oppositioneller Seite ist die Aufregung, teils Bestürzung, teils Erbitterung, außerordentlich. Endlich ist die Ruhe so weit hergestellt, dass die Abstimmung in Scene gehen kann – nicht mittels Namensaufrufes, sondern durch Aufstehen und Sitzenbleiben. Das Resultat: an drei Viertel der Versammlung haben den Schluss der Debatte angenommen. So geschehen am 15. Tag der Debatte, nachdem 67 Väter ad rem gesprochen, und obwohl fast eben so viele noch auf der Rednerliste standen.
Rom, 5. Juni 1870. [Der Handstreich der Concilsmajorität.] In Folge der Überrumpelung durch die Majorität haben sich gestern die Väter der Opposition bei Cardinal Rauscher versammelt und eine Protestation zur Überreichung an den Heiligen Vater beschlossen, welche sogleich mit Unterschriften bedeckt war. Leider sind mehrere, früher der Widerstandspartei angehörige Mitglieder jetzt in das päpstliche Lager übergegangen. Als solche Überläufer werden vor allen der Erzbischof von Köln, dann einige französische Bischöfe bezeichnet. Nach diesem auffallenden Schritte der Curie gibt es kaum noch Zweifel, dass die Unfehlbarkeit verkündigt werden wird, wie es von langer Hand her vorbereitet war.
Nach dem neuen perfiden Streich, welchen die Jesuitenpartei der liberalen Fraction gespielt hat, wobei sie die Schamlosigkeit so weit getrieben hat, jede parlamentarische Rücksicht beiseite zu setzen, haben mehrere Bischöfe bereits geäußert, dass sie nach der feierlichen Erklärung der päpstlichen Infallibilität auf ihre bischöfliche Würde verzichten werden. Jede Hoffnung, dass der Papst noch zur Besinnung kommen und der katholischen Kirche diesen grenzenlosen Scandal seiner persönlichen Unfehlbarkeits-Erklärung ersparen werde, ist geschwunden. Pius scheint nur noch den Einflüsterungen der Jesuiten offen, und keiner der Cardinäle, nicht einmal Antonelli, hat in diesem Augenblick den geringsten Einfluss auf ihn.
Wie denn überhaupt der Cardinalstaatssecretär sich prinzipiell von allen kirchlichen Angelegenheiten fernhält und außer seinem Ministerium des Auswärtigen nur seine Privatgeschäfte und Finanzoperationen, im Vereine mit seinem Bruder, dem Director der römischen Bank, betreibt, wodurch er sich bekanntlich ein sehr bedeutendes Vermögen erworben hat.
Rom, 10. Juni 1870. [Abbruch der Generaldebatte.] Der Protest gegen den Schluss der allgemeinen Discussion am 3. Juni, aus der Feder Cardinals Rauscher, ist von 93 Bischöfen unterschrieben worden, darunter allen ungarischen und fast allen französischen. Er lautet:
"Aus dem Wesen der Concilien selbst folgt, dass die Befähigung, einem Votum auch die begründenden Motive beizugeben, nicht das ausschließliche Privilegium einiger Väter, sondern ein allen gemeinsames Recht ist. Dieses muss um so gewissenhafter gewahrt werden, je bedeutender die Frage ist, um die es geht; die allerbedeutendste Frage aber ist eine Definition, welche dem christlichen Volk eine Lehre als eine von Gott geoffenbarte vorlegt. Jenes unverbrüchliche Recht wird in den Generalcongregationen geübt, und darum kann auch eine Mehrheit diese Discussion nicht zum Abbruch bringen, ohne besagtes Recht zu schädigen. Dies aber ist gestern geschehen, und darum bezeugen wir hier unseren offenen Protest."
Schon die große Anzahl der Unterzeichner beweist, dass die Behauptung, es hätten sich bei der Abstimmung über den Antrag nur 30 Bischöfe dem Schluss der Discussion widersetzt, eine reine Erfindung ist. Es waren eben viele von der Minorität nicht im Saale anwesend, und die Präsidenten haben dem lebhaft geäußerten Verlangen der überraschten Opposition, die Gegenprobe anzustellen, kein Gehör gegeben.
Das Ganze erweist sich immer mehr als ein vor der Hand abgekartetes Spiel. Es zeigt, dass die Kirche vom modernen Parlamentarismus zwar nicht dessen Principien von Öffentlichkeit und gerechter Repräsentation zu übernehmen bereit ist – denn dann dürften nicht die Italiener die Mehrheit des gesamten Concils ausmachen –, wohl aber die Tricks und Methoden seiner Geschäftsordnung, mit denen immer wieder Majoritäten die Minorität zum Schweigen bringen. Allerdings geht es hier ja nicht um zeitlich gebundene Zwecke und Interessen, die später mit gewandelten Mehrheitsverhältnissen auch wieder neu verhandelt und entschieden werden können, sondern angeblich um göttlich geoffenbarte Glaubenswahrheit. So reiht sich denn dieses vaticanische Concil würdig ein in die lange Reihe vorangegangener Concilien, denen es wie dem jetzigen mit Drohung, Druck und Betrug weniger um die Wahrheit ging, als um die Macht – in der Kirche und in der Welt.
Rom, 19. Juni 1870. [Cardinal Guidi.] Wie eine Bombe schlug hier die gestrige Rede des Cardinals Guidi ein, der bisher allgemein als Vertreter der Infallibilität galt. Guidi verlangte nämlich, diejenigen mit dem Kirchenbann zu belegen, die behaupteten, der Papst könnte allein und ohne Zustimmung der Kirche irgendeine dogmatische Entscheidung treffen. Die Aufregung war ungeheuer. Noch für den selbigen Abend wurde Guidi in den Vatican citiert; man vermutet, dass man ihn zum Widerruf zwingen will.
Rom, 24. Juni 1870. [Die neuen Berater des Papstes.] Da der Einfluss des Erzbischofs von Westminster und seines Freundes Dechamps in jeder neuen Phase, die das Concil durchmachte, immer mehr wuchs, und da der Papst sich persönlich der Auffassung der beiden durchaus zuneigt, so mussten die von früher bewährten Ratgeber nach und nach seitwärts treten. Er befindet sich in diesem entscheidenden Augenblick so sehr in den Händen der obwaltenden Partei, dass er selbst auf die Vorstellungen des Cardinal-Staatssecretärs Antonelli wenig achtet. Dieser selbst macht auch gar kein Hehl mehr daraus, wenn er mit Personen, die ihm näher stehen, zu tun hat, indem er geradezu erklärt, in der Angelegenheit der Infallibilität einflusslos geworden zu sein, da er nicht mehr um seine Meinung gefragt werde.
Es ist diese Wandlung in der Haltung des Papstes gegenüber Antonelli manchem ein Rätsel. Antonelli war in den drangsalvollen Zeiten nicht von seiner Seite gewichen; beider Männer Verhältnis hatte im Unglück eine aufrichtige Freundschaft geschaffen. Wie mächtig muss die Phalanx sein, die in den letzten Monaten das ganze Regierungssystem lahmlegen konnte, welches in der Person Antonelli's vertreten war!
Vom Main, 25. Juni 1870. [Trennung von Kirche und Staat.] Der "Süddeutsche Telegraph" fordert als Schlussfolgerung aus dem geplanten Unfehlbarkeitsdogma: "Der Staat muss endlich aufhören, der Kirche seine Autorität zu leihen. Die Glaubensfreiheit gebietet, dass jede Religionsgemeinde ihre Angelegenheiten selbständig ordne, und zwar nach Statuten ordne, welche dem Staat zur Bestätigung vorgelegt werden müssen. Diese Statuten müssen die Bestimmung enthalten, dass nicht von außerhalb ernannte Bischöfe und Geistliche, sondern die im Staat existierenden Gemeinden und Religionsgesellschaften Eigentümer des Kirchenvermögens sind."
Graz, 26. Juni 1870. [Aus dem Beichtstuhl.] Die "Grazer Tagespost" berichtet über ein interessantes Urteil des Grazer Landes- und des Oberlandesgerichtes. Der Staatsanwalt hatte eine Nummer des "Freidenker" confiscieren lassen, weil er in dem Artikel "Enthüllungen aus dem Beichtstuhl" Religionsverspottung witterte. Beide Tribunale lehnten die Einleitung einer Anklage ab und gaben das Blatt frei. Es ist der Mühe wert, die Gründe zu hören:
"In dem Artikel wird nicht eine Einrichtung der katholischen Kirche herabgewürdigt, sondern nur der Missbrauch derselben an den Pranger gestellt: und leider lehrt es die tägliche Erfahrung, wie oft ganz unschuldige Mädchen im Beichtstuhl durch detaillierte Behandlung geschlechtlicher Verirrungen, von denen das unschuldige Wesen noch keine Ahnung hatte, verdorben werden, weil da früher ungekannte Ideen und Lüste erst geweckt werden. Ebenso ist es Tatsache, dass der Beichtstuhl zu Wahlagitationen und anderen weltlichen Dingen missbraucht wird. Dergleichen Dinge öffentlich geißeln, kann aber gewiss keine strafbare Handlung im Sinne des österreichischen Gesetzes sein."
Bonn, 30. Juni 1870. [Bischof und Jesuiten.] Die "Bonner Zeitung" schreibt: "Wir teilten jüngst andeutungsweise in einem unserer Concilartikel mit, Katholiken dieser Stadt sei von hiesigen Jesuitenpatres die sacramentale Lossprechung deshalb verweigert worden, weil sie noch nicht an die päpstliche Unfehlbarkeit glaubten. Die Sache wurde kürzlich amtlich an die Erzbischöfliche Behörde in Köln berichtet, woraufhin Weihbischof Dr. Baudri antwortete, die Behörde könne in der Sache nichts machen, da die Jesuiten der Jurisdiction des Erzbischofs entzogen seien! Die Sache bedarf keines weiteren Commentars: die Bischöfe sind nicht mehr Herren ihrer Diöcese, die Jesuiten bilden eine Kirche in der Kirche."
Rom, 1. Juli 1870. [Vom Concil.] Man ist jetzt mit Urlaubsbewilligungen nicht karg. Sechs französische, zwei englische und einige amerikanische Bischöfe, sämtlich Gegner des Infallibilitäts-Dogmas, sind bereits abgereist; auch der Bischof von Breslau hat schon seinen Paß verlangt und sich nur durch die Bitten seiner deutschen und ungarischen Amtsbrüder, welche den Vertreter einer so wichtigen Diöcese nicht beim entscheidenden Kampfe missen wollten, zum ferneren Bleiben bestimmen lassen. Man kann indessen mit Bestimmtheit behaupten, dass die Opposition, welche zu Anfang des Concils 200 Mitglieder zählte, sich kaum mehr auf 100 Mann summiert.
Andererseits könnte es sein, dass das Beispiel des Cardinals Guidi das Eis gebrochen hat, welches bis jetzt einigen freier denkenden Mitgliedern des heiligen Collegiums die Zungen gebunden hielt. Nicht weniger als drei Cardinäle, so versichert man, seien bereit, in dem nämlichen Sinne, wie der hochgestellte Sohn des heiligen Dominicus de Guzman – den, nebenbei gesagt, die Curie zum Widerruf seiner Äußerungen zwingen will – sich gegen die persönliche und separate Infallibilität des Papstes auszusprechen. Es seien das die Cardinäle di Pietro, de Silvestri und Panebianco, welcher Letztere vielfach als der präsumtive Nachfolger des Heiligen Vaters angesehen wird.
Rom, 2. Juli 1870. [Ein Antrag für den heiligen Joseph.] 150 Cardinäle, Patriarchen und Bischöfe haben folgenden Antrag im Concil eingebracht: "Es ist Niemandem unbekannt, dass der selige Joseph durch eine ganz besondere Fügung Gottes unter allen anderen Männern auserwählt worden ist, der Ehegemahl der jungfräulichen Gottesmutter und, nicht durch Zeugung, sondern durch die Liebe zu Gott und den Menschen, der Vater des Wortes, das da Fleisch geworden ist, zu werden. Die unterzeichneten Bischöfe, wohl wissend, dass seit langem im ganzen Weltall ein inbrünstiges Verlangen besteht, die öffentliche Verehrung des heiligen Joseph immer mehr zunehmen zu sehen, stellen mit inständigen Bitten und demutsvoller Ergebenheit das Begehren, dass das hochheilige Concil, gerührt durch so zahlreiche und lebhafte Wünsche, sein Ansehen gebrauche, um feierlich zu decretieren: 1) dass, nachdem der selige Joseph in seiner Eigenschaft als Vater Jesu Christi hoch über alle Geschöpfe gestellt worden, die Congregation der heiligen Riten ihm künftig in der katholischen Kirche und in der heiligen Liturgie nach der allerseligsten Gottesmutter eine Verehrung zugestehe, welche diejenige aller übrigen Heiligen überragt; 2) dass derselbe heilige Joseph, dem einst die Obhut der Heiligen Familie übertragen worden, nach der allerseligsten Jungfrau zum fürnehmsten Patron der katholischen Kirche erklärt werde."
|
|
|
Kriegsdrohungen
|
|
|
Ems, 23. Juni 1870. [Der König.] Seit Montag weilt zur Freude aller Curgäste wieder Se. Majestät der König Wilhelm allhier, gebraucht die Brunnen- und Badecur, erscheint morgens und abends in heiterster Stimmung auf der Promenade, und unterhält sich hier mit fürstlichen Personen, mit Militärs und anderen bekannten Persönlichkeiten. Das Publikum, in welchem alle Nationalitäten vertreten, benimmt sich dabei höchst tactvoll, so dass der König während der Bewegung im Freien in keiner Weise belästigt wird.

Paris, 1. Juli 1870. [Gesetzgebender Körper.] Wir kommen noch einmal auf die Sitzung vom 30. Juni zurück. Jules Favre schloss seine Rede mit den Worten:
"Es ist ein verhängsnisvoller Irrtum, zu glauben, dass eine Nation nur durch die Höhe ihres militärischen Kraftaufwandes geschützt sei; sie ist es vor allem anderen durch die Weisheit ihrer Regierung und Achtung des Rechtes. Es ist also notwendig, dass jedermann sie für weit entfernt von einem dieser Kriege halte, welche eine Dynastie vielleicht für notwendig erachten mag, um entweder ihrem Ehrgeiz oder ihren Ansprüchen auf Größe Genüge zu leisten. (Unterbrechung.) Wo ist denn heute die Bedrohnis, wo ist die Gefahr? Wenn wir stark genug sind, um diese Verbindungen der Völker, welche das Gefühl der Brüderlichkeit gegenseitig zueinander hinzieht, nicht zu fürchten, weshalb uns voll Misstrauen gegen sie bewaffnen? Diese große Frage ist nicht aufgeworfen, und ich kann sie hier nicht behandeln. Aber sie wird zur Sprache kommen, und wir werden dann fragen, was man für den Frieden getan hat. Dieses große Wort 'Frieden' ist ohne Aufhören in dem Munde der Minister, wie auch jenes, 'Freiheit', aber man tut weder für das eine noch für das andere etwas." (Lärm.)
Paris, 3. Juli 1870, abends. [Ein Hohenzoller als Throncandidat.] Dem Bureau Havas wird aus Madrid gemeldet, dass das Ministerium beschlossen habe, dem Prinzen von Hohenzollern die Krone anzubieten. Eine Deputation, welche beauftragt ist, den Prinzen hiervon zu verständigen, wäre bereits, wie versichert wird, nach Deutschland abgereist.
Paris, 4. Juli 1870, abends. [Zur spanischen Thronfrage.] Die Presse und die Liberté greifen das Cabinett heftig an, weil es dulde, dass Bismarck einen Hohenzollernschen Prinzen auf den spanischen Thron bringe, während die französische Regierung arglos mit Prim wegen eines Jurisdictions-Vertrags verhandelt habe. Die Presse behauptete übrigens, dass nach der heutigen Audienz des Herzogs von Gramont beim Kaiser ein Courier mit Depeschen an Benedetti nach Berlin abgegangen sei.
Paris, 6. Juli 1870. [Kriegsdrohungen.] Aus den hiesigen officiösen Abendblättern spricht die größte Aufregung. Das Pays beginnt seinen Der Krieg überschriebenen Leitartikel wie folgt:
Was nur ein Gerücht war, ist Wirklichkeit geworden: der Prinz von Hohenzollern hat die ihm von General Prim angetragene Krone von Spanien angenommen. Preußen legt die Hand auf Spanien. Der Kaiser hat dem preußischen Botschafter in Paris, Hrn. v. Werther, erklärt, dass Frankreich das nicht leiden werde. Herr v. Werther ist gestern abend abgereist, um seiner Regierung über die Entschließungen Frankreichs Bericht zu erstatten. Wir haben also ein ungeheures Ereignis zu gewärtigen: heut abend, morgen kann der Krieg vielleicht erklärt sein. Es braucht nur ein Schwindel sich unserer Nachbarn zu bemächtigen, und die Würfel wären geworfen! Denn – das wissen wir aus sicherer Quelle – Frankreich wird nicht zurückweichen. Entweder Preußen zieht seine Ansprüche zurück, oder es muss sich schlagen. Ein Drittes, einen Ausgleich, ein juste milieu gibt es nicht. Entweder es gibt nach, oder die Kanone wird die Discussion fortsetzen.
Berlin, 7. Juli 1870. [Prinz Leopold.] Erbprinz Leopold von Hohenzollern-Sigmaringen ist der neueste Schrecken und Entrüstungs-Gegenstand für die Franzosen. Sie sollten sich jedoch die Sache etwas ruhiger überlegen. Der Erbprinz Leopold ist, trotz seines Namens, keineswegs ein "preußischer Prinz", vielmehr näher verwandt mit der Familie Napoleons, als mit dem preußischen Hofe. Denn die Großmutter dieses 35jährigen Erbprinzen auf Vaterseite war Marie Antoinette Murat, und seine Großmutter auf Mutterseite war die Vicomtesse Stephanie von Beauharnais, Adoptivtochter Napoleons I., welche Großherzogin von Baden wurde. Der Vater dieses Erbprinzen, der Fürst Carl Anton von Hohenzollern, ist nämlich der Sohn der genannten Prinzessin Murat; und die Mutter des Erbprinzen, die Prinzessin Josephine von Baden, ist die Tochter der genannten Prinzessin Stephanie. Der sehnsüchtig nach einem König für Spanien ausschauende Marschall Prim, jedenfalls im Einvernehmen mit dem Regenten Serrano, hat offenbar an dem Erbprinzen Leopold darum eine besonders passende Acquisition zu machen geglaubt, weil er 1) doppelt mit dem Napoleonischen Hause verwandt, 2) seit 1861 mit der Prinzessin Antonie von Portugal, Schwester des regierenden Königs von Portugal, vermählt ist, also ein Stück "iberische Idee" vertritt.
Man wird sich in Paris wohl erst etwas besser informieren und dann den Ton der Erschreckten und gleichzeitig Übermütigen wohl aufgeben!
Paris, 8. Juli 1870. [Kriegsgeschrei der Pariser Presse.] Das Pays kennt gar kein Ziel und Maß mehr in seinem kriegerischen Übermute. Es schwingt den Säbel und ruft: "Die Echos des deutschen Rheines sind noch stumm. Hätte Preußen zu uns gesprochen, wie wir zu ihm, so wären wir schon lange unterwegs."
Der Moniteur, das intime Organ Ollivier's, schreibt: "Kein Zaudern mehr; die französische Regierung befindet sich dem augenscheinlich bösen Willen des Marschalls Prim und des Herrn v. Bismarck gegenüber. Letzterer, der immer bereit ist, Frankreich Feinde zu schaffen und seit 3 Jahren Spanien angeht, sich ihm anzuschließen, hat die Schritte bei dem Prinzen von Hohenzollern ermutigt. Die preußische Regierung (!) hat über die spanische Frage verhandelt (!) als ob wir nicht da wären. Nun stellt sie sich, als sei sie erstaunt, dass wir so sehr verletzt sind. Dabei kann kein Zweifel bestehen: der Marschall Prim und Hr. v. Bismarck sind einig geworden, die Ruhe Europas zu stören. Wir erlauben uns, der Regierung zu raten, nicht mehr länger zu zögern."
Wie man in den militärischen Kreisen versichert, trifft man bereits militärische Vorbereitungen. Es werden zwar noch keine Truppen zusammengezogen, aber man hat bereits bestimmt, welche Marschälle und Generäle die einzelnen Corps befehligen sollen, und letztere auf dem Papier zusammengestellt. Mit dem Ankauf von Vorräten für die Armee ist auch bereits begonnen.
Madrid, 9. Juli 1870. [Spanien zur Thronfrage.] Die spanische Regierung hat ihre Vertreter im Auslande beauftragt, entschieden der Ansicht entgegenzutreten, als sei die Candidatur des Prinzen Leopold von Hohenzollern als feindseliger Akt gegen Frankreich oder dessen Regierung aufzufassen. Ebensowenig habe sich Prim an den Grafen Bismarck gewandt, um durch denselben die Zustimmung des Königs von Preußen zu erlangen. Die Verhandlungen seien ausschließlich mit dem Prinzen Leopold selbst geführt worden, ohne jegliche Mitwirkung des Grafen Bismarck.
Paris, 10. Juli 1870. [Zur Thron-Candidatur.] Der Constitutionnel schreibt: Preußische Blätter versichern uns mit einer Mäßigung der Sprache, der wir gern unsere Anerkennung zollen, dass Preußen der Candidatur des Prinzen von Hohenzollern ganz fern stehe. Wenn dem wirklich so ist, dann gibt es zwischen den Cabinetten von Paris und Berlin keine Missstimmung mehr. Aber die Versicherungen der deutschen Zeitungen können nicht genügen. Ist Preußen nicht in die Unterhandlungen zwischen Prim und dem Prinzen Leopold verwickelt, so kann es leicht seine Aufrichtigkeit dadurch erweisen, dass es den Prinzen nötigt, die gegebene Zusage zurückzunehmen. Der Friede Europas liegt also heut in der Hand Preußens.
Paris, 11. Juli 1870. [Französische Forderung.] Der Constitutionnel sagt anschließend an seine letzte Meldung, dass durch Benedetti vom König von Preußen in Ems verlangt worden sei, dass er den Prinzen von Hohenzollern veranlasse, die spanische Krone abzulehnen. Benedetti sei angewiesen, auf Beschleunigung der Antwort zu drängen, da man für dieselbe nur ein kurze Frist gewähren könne.
Sigmaringen, 12. Juli 1870. [Thronverzicht.] Es wird bestimmt gemeldet, dass der Prinz Leopold sich entschlossen habe, auf die Throncandidatur Spaniens zu verzichten, weil er es "mit seinen Gefühlen als preußischer und deutscher Offizier nicht vereinbaren könne, Deutschland um seiner Person willen in den Krieg zu ziehen und Spanien zur Mitgift blutigen Kampf zu bringen."
Paris, 13. Juli 1870. [Zum Thronverzicht.] Der Constitutionnel, der als Ollivier's Organ gilt, schreibt:
Die Regierung hat ihr Wort gehalten. Die Candidatur eines deutschen Prinzen zum spanischen Throne ist beseitigt, und der Friede Europas wird nicht gestört werden. Die Minister des Kaisers haben laut und fest geredet, wie es sich ziemt, wenn man die Ehre hat, ein großes Land zu regieren. Sie sind gehört worden, man hat ihren gerechten Forderungen Genugtuung gegeben. Der Prinz von Hohenzollern wird nicht in Spanien regieren. Wir verlangten nicht mehr, und mit Stolz begrüßen wir diese friedliche Lösung. Ein großer Sieg, der nicht eine Träne, nicht einen Tropfen Blut kostet.
Paris, 13. Juli 1870, abends. [Eine neue Provocation.] Die France veröffentlicht heut einen neuen provocierenden Artikel, in welchem sie sagt: Bis zum gegenwärtigen Augenblick sei keine für Frankreich befriedigende Lösung gefunden worden. Es handle sich um eine internationale Frage, Frankreich kann dieselbe nur mit Preußen verhandeln. Es sei notwendig, dass seitens der preußischen Dynastie ein authentisches Protokoll unterzeichnet werde, mittelst welchem dieselbe die feierliche unwiderrufliche Verpflichtung eingehe, für kein Mitglied ihrer Familie oder einen ihrer Angehörigen die spanische Krone anzunehmen. Jede andere Lösung sei ebenso illusorisch als lächerlich.
Berlin, 14. Juli 1870. [Depesche aus Ems.] Es geht uns am Schluss unseres Blattes noch folgende wichtige Nachricht zu, welche das Hinausschieben definitiver Äußerungen der französischen Regierung vor dem gesetzgebenden Körper erklärt:
Nachdem die Nachrichten von der Entsagung des Erbprinzen von Hohenzollern der kaiserlich französischen Regierung von der königlich spanischen amtlich mitgeteilt worden sind, hat der französische Botschafter in Ems an Se. Majestät den König noch die Forderung gestellt, ihn zu autorisieren, dass er nach Paris telegraphiere, dass Se. Majestät der König sich über alle Zukunft verpflichte, niemals wieder seine Zustimmung zu geben, wenn die Hohenzollern auf ihre Candidatur zurückkommen sollten. Se. Majestät der König hat es darauf abgelehnt, den französischen Botschafter nochmals zu empfangen, und demselben durch den Adjutanten vom Dienst sagen lassen, dass Se. Majestät dem Botschafter nichts weiter mitzuteilen habe.
Bad Ems, 15. Juli 1870. [Benedetti und der König.] Über den Vorfall vom 13. ist inzwischen folgendes bekanntgeworden: Der französische Botschafter, Graf Benedetti, sprach den König auf der Promenade an, um an ihn die Forderung zu stellen, Garantien gegen die Wiederkehr ähnlicher Complicationen, wie es die gegenwärtigen sind, zu bieten, und speciell an ihn das Ansinnen zu stellen, an den Kaiser Napoleon einen diesbezüglichen Brief zu schreiben. Der König begnügte sich, den Botschafter darauf aufmerksam zu machen, dass dies nicht der Ort sei, wo man über derartige Dinge spreche. Se. Majestät kehrte aber sofort in seine Wohnung zurück, wohin ihm der Botschafter unmittelbar folgte. Als derselbe sich hatte anmelden lassen, entsendete der König seinen Flügeladjutanten, Grafen Lehndorff, um dem Grafen Benedetti sagen zu lassen, dass er mit ihm über den Gegenstand überhaupt nicht mehr zu sprechen habe und ihn deshalb nicht empfangen wolle.
London, 15. Juli 1870. [Zur Tagesfrage.] Seit dem Eintreffen der Meldung aus Bad Ems, dass der französische Botschafter mit neuen Forderungen inhaltsschwerer Bedeutung und mit Hintansetzung aller Etiquette an den König von Preußen sich gedrängt habe, ist es hier allgemeine Überzeugung geworden, dass es Frankreich auf eine Demütigung Preußens abgesehen habe und dass ein Krieg nun schwer zu vermeiden sei. So schreibt die Times: "Der Rücktritt des Prinzen genügt der französischen Regierung nicht, sie will Garantien für alle Zukunft, dass nie ein Hohenzoller den spanischen Thron annehme. Sie vergisst dabei, dass selbst ein Staat zweiten oder dritten Ranges sich eine derartige Zumutung niemals gefallen lassen könnte."
Berlin, 15. Juli 1870. [Die französische Anmaßung.] Das Urteil der deutschen Blätter über die Vorgänge in Ems am 13. ist einstimmig. Die "Weser-Zeitung" schreibt hierzu:
Was diese authentische Depesche bedeutet, wird sich Jedermann selbst sagen. Eine maßlose Insolenz, wie sie selbst Kaiser Napoleon I. in den Zeiten seines größten Übermuts sich kaum erlaubt hat, hat die gebührende, die einzig mögliche Antwort gefunden. Dem die eigenste Person des Kaisers Napoleon vertretenden französischen Botschafter ist die Türe gewiesen worden. Ganz Deutschland, jeder Mann von Ehre außerhalb Frankreichs, der nicht unsere Demütigung will, wird die einfache, natürliche und doch so stolze Handlungsweise des Königs billigen müssen, Die Anmutung, welche der französische Botschafter gestellt, enthüllt so unzweideutig das nichtswürdige Verlangen Frankreichs, Deutschland in eine Stellung zu drängen, in der nur Erniedrigung oder derbe Abwehr übrig bleibt, dass nunmehr auch dem blödesten Auge klar wird: Frankreich will den Krieg, will den Krieg um jeden Preis, und wir müssen gestehen, dass nur ein Wunder ihn noch abwenden kann. König Wilhelm I. kann vor Gott und den Menschen sich mit gutem Gewissen das Zeugnis geben, dass er keine Schuld an den schweren Folgen trägt, welche die letzte Abweisung französischer Anmaßung nach sich ziehen wird.
Paris, 15. Juli 1870. [Der Krieg.] In der heutigen Sitzung des gesetzgebenden Körpers verlas der Siegelbewahrer Ollivier folgende Erklärung:
Meine Herren! Die Art und Weise, wie Sie die am 6. Juli von der Regierung abgegebene Erklärung aufgenommen, hatte uns die Gewissheit verschafft, dass Sie unsere Politik billigen und dass wir auf Ihre Unterstützung zählen können.
Von dem spanischen Botschafter empfingen wir die Anzeige, dass der Prinz von Hohenzollern seine Bewerbung zurückgezogen habe. Wir haben vom preußischen Könige verlangt, er solle dieser Verzichterklärung beitreten und sich verpflichten, wenn die Krone nochmals dem Prinzen Leopold angeboten werde, seine Genehmigung dazu zu versagen. Der König hat sich geweigert, die geforderte Verpflichtung zu übernehmen; trotzdem brachen wir, bewegt von einem Wunsche nach Frieden, nicht die Unterhandlungen ab. Unsere Überraschung war groß, als wir erfuhren, der König habe sich geweigert, Hrn. Benedetti zu empfangen, und habe die Tatsache seinem Cabinette in officieller Weise mitgeteilt. Unter dieses Umständen wäre es ein Vergessen unserer Würde und eine Unvorsichtigkeit gewesen, keine Vorbereitungen zu treffen, um den Krieg, den man uns bietet, aushalten zu können. Seit gestern haben wir die Reserven einberufen, und wir werden Maßnahmen ergreifen, um die Interessen, die Sicherheit und die Ehre Frankreichs zu wahren. (Enthusiastischer und lang andauernder Beifall.)
|
 |
|
Pius IX. am Ziel
|
 |
 |
|
“Da ja auch Papst Leo X. in Dingen des Glaubens unfehlbar war, so gilt das Gesetz, wonach Ketzer zu verbrennen sind, in der katholischen Kirche unverbrüchlich weiter – sie verzichtet lediglich zeitweilig auf seine Befolgung.”
St. Petersburg, 3. Juli 1870. [Die Ketzerverbrennung als Kirchengesetz.] Dr. Pichler hat von hier folgendes neue Schreiben an den Bischof Ketteler von Mainz gerichtet:
Hochwürdigster Herr Bischof! Heute erst erhalte ich Kenntnis von Ihrer mich überaus ehrenden, ganz unerwarteten Beantwortung meines Briefes, leider nur aus den Zeitungen. Zwar betrübt mich der Gedanke, von Ew. bisch. Gnaden und den übrigen, wie Sie behaupten, "in wunderbarer Einheit" innig verbundenen Bischöfen des Vaticanischen Concils als ein "vom Glauben Abgefallener" betrachtet zu werden. Doch tröstet mich Ihre Versicherung, dass Sie auch außerhalb dieses Kreises ein "Christentum", wenn auch "keine wahre christliche Kirche" anerkennen.
Ew. bischöfl. Gnaden werfen mir vor, ich "missdeutete die Bedeutung der Anatheme". Dabei wissen Sie doch so gut wie ich, dass die vom Kirchenbanne und der päpstlichen Verdammung Betroffenen verbrannt wurden, solange die Kirche die Macht dazu besaß. Dass Ew. Gnaden behaupten, die Verbrennung Andersgläubiger sei nicht wirklich von der Kirche gewollt und angeordnet worden, erstaunt mich zutiefst. Denn es dürfte Ihnen bekannt sein, dass die 33. der Thesen von Luther lautete: Haereticos comburi est contra voluntatem Spiritus. Diese These aber wurde vom Papst Leo X. in seiner dogmatischen Bulle vom 16. Mai 1520 selber als ketzerisch verdammt, so dass folglich mit Leo X. gilt: Die Ketzer zu verbrennen entspricht dem Willen des Heiligen Geistes. Und da ja auch Papst Leo X. in Dingen des Glaubens unfehlbar war, wie Sie jetzt festzustellen im Begriffe sind, so gilt das Gesetz, wonach Ketzer zu verbrennen sind, in der katholischen Kirche unverbrüchlich weiter – sie verzichtet lediglich zeitweilig auf seine Befolgung. Oder würden Sie etwa meinen wollen, Papst Leo X. hätte geirrt?
Rom, 3. Juli 1870. [Abstimmungen.] Das Concil votierte gestern die Vorrede und die beiden ersten Kapitel des Entwurfs über den Primat und über die Unfehlbarkeit. Die Discussion über das vierte Kapitel wird noch fortgesetzt. – Die exaltierten Anhänger der Unfehlbarkeit bestehen darauf, jede Form eines Vergleiches zurückzuweisen und beantragen Schluss der Discussion. Wenn dieses Verlangen nicht erfüllt wird, dürfte die Discussion noch einen Monat dauern.
Rom, 5. Juli 1870. [Vom Concil.] Es war keine geringe Überraschung, die Väter heute schon gegen 10 Uhr aus der Concils-Aula zurückkehren zu sehen. Der Grund dieser unerwarteten Erscheinung blieb nicht lange verborgen: sämtliche Candidaten der Rednerliste hatten sich ihres Rechtes begeben, die Discussion war geschlossen worden. So hat es sich bewährt, was bereits ein Witzblatt vorausgesagt hatte, dass die Hitze und das Fieber die besten Bundesgenossen der päpstlichen Infallibilität sein werden. Morgen soll die Abstimmung beginnen, erst über das dritte Capitel, dann über das vierte. Bleiben die Stimmen, wie vorauszusetzen ist, geteilt, so wird die Entscheidung des H. Vaters den Ausschlag geben. Die ungarischen Bischöfe werden nur dann an der Abstimmung teilnehmen, wenn bei derselben das mündliche Verfahren eingehalten wird.
Rom, 5. Juli 1870. [Das Concil der Italiener.] Der Bischof von Orleans hat nachgewiesen, dass im Concil allein 276 italienische Bischöfe sitzen. Gleichfalls Italiener sind 51 Abbés oder Ordenshäupter, sowie 120 der vom Papst selber bezahlten Bischöfe und Erzbischöfe in partibus infidelium, die keine Gemeinde haben und nur dem Namen nach Bischöfe sind. Das gesamte übrige Europa hat insgesamt nur 265 katholische Bischöfe, so dass die Patriarchen, Primaten, Erzbischöfe und Diöcesanbischöfe der ganzen sonstigen Welt neben den italienischen in der Minderheit sind.
Rom, 13. Juli 1870. [Abstimmung zur Unfehlbarkeit.] Diesen Morgen hat das Concil über das Schema von der Unfehlbarkeit im Block abgestimmt. 600 Bischöfe waren anwesend. Davon stimmten ablehnend: 88 uneingeschränkt (non placet), 62 mit Einschränkungen (placet juxta modum), 81 enthielten sich der Abstimmung.
Trotz all der Intrigen und Demütigungen, welche die Minorität in den letzten Monaten über sich ergehen lassen musste, bekannten sich immer noch 231 als Gegner der Unfehlbarkeit. Und von den 900 Bischöfen, die zu Beginn des Concils stimmberechtigt waren, stellten sich zu guter Letzt nur 370 als Anhänger der Unfehlbarkeit heraus, darunter neben der Überzahl der italienischen Bischöfe und Cardinäle all die künstlich geschaffenen Bischöfe in partibus infidelium, die keine Gemeinde, keinen einzigen Gläubigen vertreten, und die als abhängige Kostgänger aus der päpstlichen Schatulle leben.
Alle civilisierten Länder mit ihren Hauptstädten gaben ein non placet ab; die Ehre des Episcopates ist gerettet. Die Majorität ist in gedrückter Stimmung. Dem schwerwiegendsten Dogma der katholischen Kirchengeschichte, so hat es sich gezeigt, fehlt in jeder Weise die moralische Einstimmigkeit, welche für Kirchengesetze stets gefordert wird.
Um den verheerenden Eindruck, den die Abstimmung in der Öffentlichkeit gemacht hat, zu übertünchen, wird man vor der Proclamation fraglos den Versuch einer weiteren "Abstimmung" unternehmen. In dieser wird man wohl der Minorität nahelegen, sich nicht zu beteiligen oder vorher abzureisen. Doch steht jetzt schon fest, dass sich die Anhänger der unerhörten Lehre von der päpstlichen Unfehlbarkeit innerhalb der gesamten Kirche in einer moralischen Minderheit befinden.
Rom, 19. Juli 1870. [Die Unfehlbarkeit.] Gestern hat die Verkündigung der Unfehlbarkeit in der Concils-Aula von St. Peter stattgefunden. Es war ein trüber Tag und in die Ceremonie hinein blitzte und donnerte es. Als die Väter die Aula verließen, wurden sie von einem abermaligen Regenguß betroffen. Am 17. Juli hatten 114 Bischöfe von der Opposition Rom verlassen; die Erklärung derselben ist vom 17. Juli und lautet:
Heiligster Vater! In der General-Congregation vom 13. d. M. gaben wir unsere Stimmen über das Schema der ersten dogmatischen Constitution von der Kirche Christi ab. Eurer Heiligkeit ist bekannt, dass 88 Väter, gedrungen von ihrem Gewissen und aus Liebe zur heiligen Kirche, ihre Stimme mit Non placet abgaben, 62 andere mit Placet juxta modum stimmten und endlich ungefähr 80 von der Congregation abwesend waren und sich der Abstimmung enthielten. Andere sind teils wegen Krankheit, teils aus anderen gewichtigen Gründen in ihre Diöcese zurückgekehrt. So wurden Eurer Heiligkeit und der ganzen Welt unsere Vota offenkundig, und ward constatiert, von wie vielen Bischöfen unsere Anschauung gebilligt wurde; auf diese Weise erfüllten wir das Amt und die Pflicht, welche uns obliegen. Von jenem Zeitpunkte an aber ereignete sich ganz und gar nichts, was unsere Anschauungen ändern könnte, dagegen fielen viele, und zwar äußerst gewichtige Dinge vor, welche uns in unserem Vorsatze bestärkten.
Deshalb erklären wir, dass wir unsere bereits abgegebenen Vota erneuern und bestätigen. Indem wir durch diese Eingabe unsere Vota bestätigen, beschließen wir zugleich, uns von der öffentlichen Sitzung, welche am 18. d. M. gehalten werden soll, fernzuhalten. Die kindliche Pietät und Verehrung, von welchen jüngst unsere Abgeordneten zu Füßen Eurer Heiligkeit geführt wurden, gestatten uns nicht, in einer Sache, welche die Person Eurer Heiligkeit so nahe angeht, öffentlich und im Angesicht des Vaters Non placet zu sagen. Und dennoch könnten wir in der feierlichen Sitzung nur die in der General-Congregation abgegebenen Vota wiederholen.
Wir kehren daher ohne Aufschub zu unseren Herden zurück, denen nach so langer Abwesenheit wegen der Kriegsbefürchtungen und besonders wegen ihrer höchsten geistlichen Bedürfnisse unsere Gegenwart äußerst notwendig ist, in der schmerzlichen Gewissheit, dass wir wegen der gegenwärtigen traurigen Zeitumstände unter unseren Gläubigen auch den Frieden und die Ruhe der Gewissen gestört finden werden. Unterdessen empfehlen wir die Kirche Gottes und Eurer Heiligkeit, der wir unveränderte Treue und Gehorsam geloben, von ganzem Herzen der Gnade und dem Schutze unseres Herrn Jesus Christus und verbleiben Eurer Heiligkeit ergebenste und gehorsamste Söhne. Rom, 17. Juli 1870. – Folgen die Namen der ganzen Opposition samt den Orientalen.
Nach Abreise fast der gesamten Opposition ergab eine erneute "Abstimmung" nur noch 2 Gegenstimmen - ein plumpes und abgeschmacktes Manöver, das niemanden täuschen kann.
Folgendes ist der Wortlaut des Unfehlbarkeitsbeschlusses:
Treu anhängend der von Anbeginn des christlichen Glaubens überkommenen Überlieferung, zu unseres göttlichen Heilandes Ruhm, der katholischen Religion Erhöhung und der christlichen Völker Heil, unter Zustimmung des heiligen Conciliums, lehren und stellen wir fest als ein göttlich geoffenbartes Dogma: Dass der römische Papst, wenn er ex cathedra spricht, das ist, wenn er in Ausübung seines Amtes als Hirte und Lehrer aller Christen vermöge seiner höchsten apostolischen Autorität einen von der gesamten Kirche zu beobachtenden Glaubens- oder Sittensatz ausspricht, kraft göttlichen Beistandes, der ihm im heiligen Petrus versprochen wurde, mit jener Unfehlbarkeit ausgestattet ist, mit welcher der göttliche Erlöser seine Kirche bei Feststellung einer Lehre in Glaubens- oder Sittensachen ausgestattet haben wollte, und dass darum solche Feststellungen des römischen Papstes unabänderlich seien. Wenn aber Jemand dieser unserer Feststellung, was Gott abwenden möge, zu widersprechen sich herausnehmen wolle, der sei verflucht.
Weiter im nächsten Kapitel:
Nach dem Dogma: der Krieg
|
|