 |
|||||||||||||||
|
Papst Pius IX. |
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
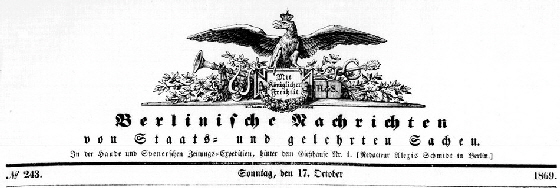 |
|
|
Feierliche Eröffnung |
||||||
 |
||||||
|
“Ihr, ehrwürdige Brüder, seid da, um über die Angriffe der fälschlich so genannten Wissenschaft mit Uns unter Anleitung des Heiligen Geistes zu richten.” Rom, 8. December 1869, abends. [Die Eröffnung des Concils.] Die feierliche Eröffnung des Concils hat heute stattgefunden. Die Ceremonie begann um 9 Uhr Morgens, und war um 3 Uhr Nachmittags beendigt. In seiner Eröffnungs-Ansprache sagte Pius IX.: Rom, 12. December 1869. [Vom Concil.] Die unter den Bischöfen herrschende Stimmung ist noch widerwilliger, als man erwartet hatte. Die ungarischen Bischöfe sind einstimmig gegen die Erklärung der päpstlichen Unfehlbarkeit, desgleichen fast alle österreichischen und viele französische Bischöfe. Besonders ungünstigen Eindruck hat es bei der Opposition gemacht, dass sie erst 24 Stunden vor Eröffnung des Concils Nachricht von der in aller Heimlichkeit vorbereiteten Eröffnungsbulle erhielt. Deren wichtigster Abschnitt de jure et modo proponendi macht das Concil zur reinen Zustimmungs-Maschine der Vorstellungen des Papstes, der sich auch das Recht anmaßt, alle Beamten des Concils zu ernennen. Noch stärkeren Unwillen erregt die Zusammensetzung der Glaubens-Congregation, die bei den Verhandlungen des Concils die einflussreichste Stellung besitzt, und der voraussichtlich nur eifrige Anhänger der Unfehlbarkeit angehören werden. Rom, 13. December 1869. [Confusion auf dem Concil.] Über die Sitzung vom 10. wird jetzt Genaueres bekannt. Zuerst sprach sich der Erzbischof von Temesvar gegen die Geschäftsordnung aus; er wurde zur Ordnung gerufen. Dem Primas vom Ungarn, der ihm beisprang, ging es ebenso. Daraufhin erhob sich der Bischof Dupanloup nach einer starken Bemerkung in gutem Französisch, und verließ die Halle, mit ihm der Erzbischof von Paris und etwa hundert andere Prälaten, woraufhin sich die Versammlung auflöste. |
||||||
|
Diese Bischöfe “in partibus infidelium” sollten sich im weiteren Verlauf als entscheidend herausstellen. Wie der Artikel vom 25. Januar 1870 aufführt, hatten die 12 Millionen deutsche Katholiken 14 Bischöfe in Rom, während allein der Kirchenstaat - mit weniger Einwohnern als Berlin - 62 Bischöfe stellte. Tatsächlich saßen, siehe Artikel vom 5. Juli 1870, mehr italienische Prälaten im Konzil als Vertreter aller anderen Länder zusammen. |
||||||
|
Ausschüsse, Anträge, Majoritäten |
||||||
|
Rom, 25. December 1869. [Excommunicationen.] Eine Correspondenz der Liberté gibt erbauliche Auszüge aus der soeben erlassenen constitutio, die feststellt, wer der Excommunication anheimfallen soll. Dazu gehören alle, die ein Buch lesen, das auf dem Index steht, die sich an der Freimaurerei beteiligen, die mit Personen verkehren, die vom Papst namentlich excommuniciert wurden, dazu diejenigen, welche auch die Geistlichen unter die weltliche Gerichtsbarkeit stellen wollen und dergleichen mehr. Was soll man da von dem Concil erwarten? Dieser törichte Erlass verdiente nur mitleidiges Lächeln, aber die französische Regierung ist darüber wirklich in Aufregung geraten. Rom, 31. December 1869. [Stand des Concils.] Die schon erwähnte, am 14. December stattgefundene Wahl in den Ausschuss für Glaubensfragen (24 Mitglieder) verlief wie erwartet: die Opposition brachte nicht Eines ihrer Mitglieder hinein. Die Majorität setzte ihre gesamte Namensliste rücksichtslos durch: ohne Ausnahme Anhänger der Unfehlbarkeit. Und die Geschäftsordnung für das merkwürdige Concil, gegen die sich die unabhängigen Stimmen ebenso nachdrücklich wie vergeblich erhoben haben, sorgt sehr weise dafür, dass keine freie Debatte aufkommen kann, dass in den Ausschüssen die ergebensten Cardinäle den Vorsitz führen, ein überraschender Widerspruch kaum möglich ist, jegliche Opposition leicht erstickt werden kann. Rom, 7. Januar 1870. [Unfehlbarkeit.] Inzwischen ist der Wortlaut der Proposition bekannt, mit welcher die Concils-Majorität die Verkündigung der päpstlichen Infallibilität beantragen will: Rom, 12. Januar 1870. [Concil.] Den gemischten Ehen sollen neue Hindernisse bereitet werden. Anstatt wie bisher von den künftigen Eheleuten das Versprechen zu verlangen, dass ihre Kinder in der katholischen Religion erzogen werden sollen, soll zukünftig die Eheschließung nur vorgenommen werden, wenn sich der "ketzerische Teil" zum katholischen Glauben bekehrt. Dass diese Anmaßungen gerade durch ihren Excess dem Zwecke zuwiderlaufen, muss jedem Besonnenen einleuchten; aber man darf nicht vergessen: wenn hunderte von Personen sich versammeln, um ihren Ansichten zum Siege zu verhelfen, so haben sie naturgemäß die Neigung, sich eine größere Gewalt beizumessen, als sie in Wahrheit besitzen. Das zeigt sich auch hier: die Herren Prälaten berauschen sich an ihren eigenen Träumen, die Luft von Rom hilft ein wenig nach. Rom, 17. Januar 1870. [Zur Geschäftsordnung.] Mit einer unverkennbaren Erhitzung der Gemüter geht die Klage über die unfruchtbare Geschäftsordnung des Concils Hand in Hand. Besonders macht es sich als immer drückenderes Hemmnis geltend, dass es den Mitgliedern der Versammlung verwehrt ist, sich in der Sitzung zu Worte zu melden, um auf irgend welche Behauptung eines Redners eine unmittelbare Erwiderung zu geben. Die Notwendigkeit, vorher ein schriftliches Gesuch an die Commission einzureichen, und die mittlerweile verfließende Zeit benimmt solchen Vorgängen jegliches Interesse. Bayreuth, 19. Januar 1870. [Freimaurer zum Concil.] In einem Rundschreiben der Großloge zu Bayreuth heißt es zu den Vorwürfen des Papstes: München, 21. Januar 1870. [Döllinger zur Unfehlbarkeit.] Stiftprobst v. Döllinger, eine der bedeutendsten theologischen Celebritäten unseres Landes, hat sich in einer vielbeachteten Erklärung scharf gegen die Lehre von der Unfehlbarkeit ausgesprochen. In seinem ausführlichen Gutachten heißt es: da nach der neuen Lehre die unfehlbare Wahrheit einzig beim Papste liegt, so können ihr auch 400 oder 600 fehlbare Bischöfe weder etwas wegnehmen noch etwas hinzufügen. Demnach ist der Papst unfehlbar, weil er selber es sagt, und so löst sich denn alles in das Selbstzeugnis des Papstes auf. Dabei hat doch vor 1840 Jahren einmal ein unendlich Höherer gesagt (in Joh. 5, 31): "Wenn ich mir selber Zeugnis gebe, so ist mein Zeugnis nicht glaubwürdig." Rom, 22. Januar 1870. [Geschäftsordnung.] Hier wird ein Schreiben bekannt, in welchem die deutschen Bischöfe konkrete Vorschläge zur Geschäftsordnung unterbreitet haben. Darin wird angeregt: "Wenn sich übrigens auch eine Örtlichkeit finden ließe, wo auch diejenigen Prälaten, welche eine schwache Stimme besitzen, ohne Schwierigkeiten zu verstehen wären, so würde es doch von hohem Nutzen sein, dass den Vätern vor Augen läge, was in den vorhergehenden Sitzungen geredet worden. Es handelt sich um Angelegenheiten von äußerster Wichtigkeit, und nicht selten ist die Hinzufügung oder Abänderung eines einzigen Wortes ausreichend, um den Sinn zu verfälschen. Außerdem wäre es wünschenswert, wenn den Vätern gestattet würde, ihre Ansicht über bedeutendere Angelegenheiten schriftlich mitzuteilen; auf diese Weise könnte nämlich Vieles hinzugefügt werden, zu dessen Auseinandersetzung in der allgemeinen Sitzung weder die Zeit noch die Lungen der Redenden hinreichen." Rom, 23. Januar 1870. [Protest der Bischöfe.] Inzwischen ist die Protestation der deutschen und österreichischen Bischöfe bekannt geworden, worin sich dieselben "auf ihr gutes, nicht von der päpstlichen Gnade abhängiges, sondern durch göttliche Institution ihnen gebührendes Recht" berufen und die Beibehaltung der Geschäftsordnung des Tridentinischen Concils verlangen. Hier heißt es: "Es ist von größter Bedeutung, was Ew. Heiligkeit in Punkt II. über innere Norm und Ordnung verfügt hat: nämlich über Recht und Befugnis im Vorlegen der Geschäfte, welche in der heil. ökumenischen Synode verhandelt werden sollen. Es fehlt nicht an Stimmen, welche das so auslegen, als würde dadurch das Recht der Väter nicht anerkannt, dass ein Jeder dem Concil vorlegen darf, was er dem öffentlichen Wohle Förderliches beibringen zu können glaubt, sondern es werde dies lediglich als Ausnahme und Gnade gestattet." Rom, 24. Januar 1870. [Adresse gegen die Unfehlbarkeit.] In ihrer an den Papst gerichteten Adresse gegen die Unfehlbarkeit schreiben die deutschen und österreichischen Bischöfe: Rom, 25. Januar 1870. [Concils-Arithmetik.] Um die Dinge, die in Rom vorgehen, zu begreifen, muss man Folgendes ins Auge fassen: Die 12 Millionen deutschen Katholiken sind gerade einmal mit 14 Bischöfen auf dem Concil vertreten. Dagegen zählt allein der kleine Kirchenstaat, mit weniger Einwohnern als die Stadt Berlin, 62 Bischöfe, die alle im Concil ihren Sitz haben. Neapel und Sicilien haben 68 Bischöfe geschickt. Mehr als 100 Bischöfe Spaniens von diesseits und jenseits des Oceans sind als bloße Handlanger der Italiener gekommen. Die 200 Missionsbischöfe und apostolischen Vicare in partibus infidelium aus Asien, Afrika und Australien leben ganz aus des Papstes Tasche, der ihnen selbst Wohnung und Nahrung gibt. In den zwei Jahren seit der Ankündigung des Concils hat der Papst nicht weniger als 89 dieser Bischöfe neu geschaffen, die keine Gemeinde, nichts als sich selbst vertreten. Wahrlich absurd: der Papst musste lediglich zählen, wie viele Stimmen ihm für die Unfehlbarkeit fehlten, um sich dann selber die Majorität dafür zu ernennen. – Pardon, es war natürlich der Heilige Geist, der die Ernennungen vorgenommen hat, und der Papst hat sie bloß unterschrieben. Berlin, 27. Januar 1870. [Die Gegenadresse der deutschen Bischöfe.] Die deutschen Bischöfe haben sich mit höchst seltsamen Gründen gegen das Dogma von der päpstlichen Unfehlbarkeit gewandt. Im wesentlichen sagen sie nämlich: wir sind nicht gegen die päpstliche Unfehlbarkeit, aber ihre Erklärung erscheint uns nicht opportun, und eine Discussion derselben wäre uns schmerzlich. Nun, auf diese Art von Einwendungen hat die Unfehlbarkeits-Adresse bereits die Antwort gegeben, und nachdem diese über 400 Unterzeichner gefunden hat, werden die Jesuiten nicht auf halbem Wege stehen bleiben. Konnten die deutschen Bischöfe nicht den Mut finden, wie ihn Döllinger fand, dann ist sicher, dass die fanatische Mehrheit über diese Bedenken zur Tagesordnung schreiten wird. So werden denn demnächst auch die Herren in Deutschland es als von Gott geoffenbart lehren: der Papst ist irrtumsfrei; und das heißt doch wohl nach menschlichen Ermessen: er ist Gott gleich. Rom, 4. Februar 1870. [21 Canones.] Die "A. A. Z." hat den ersten Teil der Canones veröffentlicht, welche als Schema "Von der Kirche Christi" demnächst im Concil beschlossen werden sollen. Darin sind die wichtigsten Sätze des umstrittenen Syllabus in positive Kirchengesetze umgewandelt worden. Hier einige Beispiele: |
||||||
|
Geheimhaltung, Zensur, Wut auf die Presse |
|
Wie jede totalitäre Herrscher sah auch Pius IX. in der Öffentlichkeit einen Feind. Je deutlicher wurde, dass alle Persönlichkeiten von Gewicht das Unfehlbarkeitsdogma ablehnten, desto mehr neigte er dazu, der Presse die Schuld daran zu geben ... auch er ein Geistesverwandter von Honecker, Trump und Co. |
|
Rom, 20. Januar 1870. [Geheimhaltung.] Obgleich man bisher geleugnet hat, dass die Bischöfe ein Gelübde zur Verschwiegenheit hätten ablegen müssen (und obwohl wir uns nicht erinnern können, dass Christus jemals einen Menschen hinweg gewiesen hätte, um mit den Jüngern geheime Dinge zu besprechen), sind die Concilsväter jetzt noch einmal in einem Brief des Concils-Secretärs ausdrücklich zur Wahrung der Geheimhaltung ermahnt worden. Begründet wird dies damit, dass "bei der Zügellosigkeit der Tagesblätter viele große Übelstände aus dem Bruch des Geheimnisses hervorgehen". Rom, 6. Februar 1870. [Ausweisung.] Seit Wochen ist bekannt, dass sich beim Papste eine zunehmende Wut über die ungünstigen Zeitungsberichte vom Concil angestaut hat. Die Wut zu stillen, brachte man ein Opfer: Hr. Dr. Albert Dressel, seit 30 Jahren in Rom ansässig und Correspondent der "Augsb. Allg. Ztg." hat am 4. Februar vom General-Secretär der römischen Polizei Befehl erhalten, Rom zu verlassen, weil er angeblich "Verfasser der feindlichen Artikel der 'Allg. Ztg.', d.h. der 'Römischen Briefe über das Concil'" sei. Obwohl die Zeitung versichert, dass Dr. Dressel nicht der Verfasser dieser Artikel ist, besteht man darauf, dass er Rom verlässt. Angeblich ging die Anweisung vom Papst selber aus: dieser wird schon wissen, warum er das Licht der Öffentlichkeit so ängstlich scheut wie der Teufel das Weihwasser. Rom, 12. Februar 1870. [Jagd auf Zeitungscorrespondenten.] In den letzten Tagen wurde hier förmliche Jagd gemacht auf Correspondenten auswärtiger Zeitungen. Der Papst ist in höchstem Grade aufgebracht über die Berichte, die über das Concil nach außen dringen. Freilich ist es merkwürdig, dass trotz des strengen Eides der Verschwiegenheit, den die Bischöfe leisten mussten, sofort Alles bekannt wird, was im Concil vorgeht, und dass sogar der Wortlaut der Actenstücke bald nach ihrem Erscheinen in fremden Zeitungen zum Abdruck kommt. Rom, 13. April 1870. [Censur.] Großes Aufsehen verursacht die hier angeordnete Beschlagnahme der Schrift des Bischofs v. Ketteler. Diese Maßnahme liefert eine treffliche Illustration von der angeblichen Neutralität des Papstes und der Freiheit, die man den Bischöfen zum Austausch ihrer Gedanken gelassen hat. Rom, 4. Mai 1870. [Censur.] Angehörige der Concils-Minorität, die ihre Meinungen und Vorschläge drucken lassen wollen, erhalten dazu in Rom keine Erlaubnis mehr. Während den Anhängern der Unfehlbarkeit alle Zeitungen und Druckereien Roms offenstehen, müssen die Gegner derselben ihrer Schriften in Neapel oder Florenz drucken lassen. |
|
Geschäftsordnungstricks |
||
|
Rom, 25. Februar 1870. [Neue Geschäftsordnung.] Mit Datum vom 22. Februar ist den Vätern das Decret mit der veränderten Geschäftsordnung zugegangen. Darin heißt es: "Der Heilige Vater hat beschlossen, einige besondere Regeln über die Discussionen der allgemeinen Congregationen zu erteilen, welche es gestatten, die zu behandelnden Fragen schneller und vollständiger zu prüfen. Nach der Verteilung des Schemas an die Väter werden die vorsitzenden Cardinäle eine Frist bestimmen, innerhalb welcher die Väter, die Einwendungen zu machen gedenken, diese schriftlich einzureichen haben. Wenn die Discussion sich mehr als billig in die Länge ziehen sollte, können die vorsitzenden Cardinäle, auf schriftlichen Antrag von mindestens 10 Vätern, an die General-Congregation die Frage stellen, ob die Debatte noch weiter fortgeführt werden soll. Nachdem durch Aufstehen oder Sitzenbleiben abgestimmt worden, werden sie den Schluss der Discussion aussprechen, wenn die Majorität der anwesenden Väter dafür ist. Rom, 16. März 1870. [Protest.] Die Opposition, so ist hier bekannt geworden, hat auch gegen die revidierte Geschäftsordnung des Concils Protest eingelegt. Allerdings deutet nichts darauf hin, dass diesem Protest mehr Erfolg beschieden sein könnte, als den früheren Protesten in derselben Angelegenheit. Rom, 25. März 1870. [Stroßmayer.] In der vorigen General-Congregation im Concil ging es wieder stürmisch zu. Der Orkan brach bei Gelegenheit eines Satzes aus dem ersten Schema los, in welchem dem Protestantismus die Vaterschaft und die Verantwortung für Naturalismus und Materialismus aufgebürdet wird. Der Bischof Stroßmayer wagte es, mit lauter Stimme zu behaupten, dass es auch unter den Protestanten manch brave und gute Leute, sogar gute Christen gebe. Die Worte waren das Signal zu einem allgemeinen Aufschrei. "Taceas! Ab ambone descendas!" erscholl es von allen Seiten. Nicht besser erging es dem Cardinal-Erzbischof von Prag, als er zu Gunsten Stroßmayer's eine Lanze zu brechen versuchte. Berlin, 10. April 1870. [Concil und Protestantismus.] Wir haben gestern die merkwürdige Betrachtung Macaulay's über die Confessionen mitgeteilt: obgleich Wohlstand, Bildung und Kenntnisse in den protestantischen Ländern weitaus schneller fortgeschritten sind als in den katholischen, steht der Katholicismus noch immer unüberwunden da. Weiter als vor dreihundert Jahren ist der Protestantismus nicht vorgedrungen. Und jetzt urteilt das "unfehlbare" Concil: Rom, 20. April 1870. [Brief vom Concil.] Dr. Pichler schreibt uns aus Rom: Man staunt hier oftmals über die liberalen und verständigen Grundsätze so mancher Bischöfe und Priester, selbst manches Monsignore, die in vertrautem Freundeskreise kundgegeben werden. Freilich muss dies ganz im Geheimen geschehen. Besonders die deutschen Bischöfe werden in Rom die Erfahrung gemacht haben, dass der römische Clerus unter den Augen des Papstes und der Cardinäle weit weniger in kleinlicher Weise bevormundet ist, als der deutsche. Der römische Abbé geht ohne Bedenken in jedes Café, er geniert sich nicht im geringsten, auf offener Straße mit Personen des anderen Geschlechts zu verkehren oder gemeinsam mit Damen auf dem Corso zu fahren, er raucht gemütlich seine Cigarren u.s.f. Rom, 24. April 1870. [Französische Note.] Die noch von dem Grafen Daru verfaßte Note an den Papst und das Concil ist gestern überreicht worden. Sie enthält ausdrücklich keine Drohung: "Ihre Intervention ist lediglich moralisch, und sie beschränkt sich auf Dinge, welche unbestreitbar zur Competenz der öffentlichen Gewalt gehören." Doch weist sie deutlich auf die möglichen Folgen der dem Concil vorliegenden Decrete hin: Rom, 10. Mai 1870. [Beust's Depesche.] Die österreichische Regierung hat die Depesche veröffentlicht, die Graf Beust im Februar an den Gesandten Graf Trauttmannsdorff sandte, welcher die darin geäußerten Bedenken dem Heiligen Stuhl vortrug. Graf Beust führt aus: |
||
|
Intermezzo: |
||
|
Boston, 15. December 1869. [Pacific-Bahn.] Dem Boston Traveller zufolge, gewinnt die Ansicht immer mehr Verbreitung, dass die Pacific-Eisenbahn in dem Klima der von ihr durchschnittenen Ebenen eine große Veränderung hervorbringe. Dasselbe Resultat hat man in anderen Teilen des nordamerikanischen Westens bemerkt, woselbst in den letzten 4 Jahren anstatt der früher anhaltenden Dürre reichlicher Regen fällt. Als Grund hierfür gibt man die gleichmäßige Verteilung der elektrischen Ströme durch die Eisenbahnschienen an. Paris, 11. Januar 1870. [Victor Noir von Prinz Napoleon erschossen.] Das Ereignis des Tages und wahrlich ein sehr trauriges ist die Tötung des Journalisten Victor Noir, eines Mitarbeiters der Marseillaise, durch den Prinzen Pierre Napoleon. Der genannte Journalist hatte sich in Begleitung des Herrn Fonvielle als Zeuge des Herrn Rochefort in Sachen eines Ehrenhandels nach Auteuil zum Prinzen begeben. Es kam zu einer lebhaften Auseinandersetzung; der Prinz ließ sich von seinem heftigen Temperamente hinreißen, ergriff eine Pistole und schoß den Schriftsteller nieder. Dieser Vorfall erregt große Erbitterung unter den Volksmassen; die Geschichte wird dem Kaiser um so größere Verlegenheit bereiten, als man schon wegen des Vorfalles des Prinzen Murat mit Comté, den ersterer durchprügeln ließ, ohne dass die Gerichte es gewagt, ihn zu bestrafen, sehr ungehalten im Publicum ist. Der Prinz ist wegen seiner Heftigkeit bekannt; schon in Rom und in Corsika war er an Auseinandersetzungen beteiligt, in deren Verlauf er einen Agenten und einen Förster erschoss.
Paris, 13. Januar 1870. [Prinz Bonaparte.] Die Marseillaise bringt heute in großen Lettern folgende Erklärung: Assuncion, 8. März 1870. [Ende des Krieges in Paraguay.] In Südamerika ist am 1. März ein fünfjähriger Krieg beendet worden, der in vieler Hinsicht merkwürdig war. Lopez, der Präsident der Republik Paraguay, der eigentliche Urheber dieses Krieges, hat am 1. März am Ufer des Aquidaban seinen Tod gefunden; treu seinem Charakter zog er, geschlagen und verwundet, den Tod der Ergebung vor. Nun erst kann dieser Krieg, welchen die Brasilianer schon 1869 mit der Einnahme der Hauptstadt Assuncion beendet zu haben glaubten, für definitiv abgeschlossen betrachtet werden. Tours, 21. März 1870. [Prozeß Bonaparte.] Unter großem Andrang des Publikums ist heute der Prozeß gegen den Prinzen Bonaparte eröffnet worden. Zahlreiche Correspondenten aus allen Ländern haben sich eingefunden. Eine große Zahl von Gensdarmen und Polizeiagenten halten die Ordnung aufrecht, so dass es bisher zu keinen Ausschreitungen gekommen ist. Tours, 27. März 1870. [Das Urteil über den Prinzen Bonaparte] wurde heut mit der größten Spannung erwartet. Nach den Plädoyers stellte der Präsident den Geschworenen folgende Fragen: Ist der Angeklagte schuldig, an der Person von Victor Noir einen Mord begangen zu haben? Lag eine Provocation vor? Kann eine legitime Selbstverteidigung angenommen werden? Paris, 28. März 1870. [Bonaparte.] Die Freisprechung des Prinzen Bonaparte bildet hier selbstverständlich das alleinige Tagesgespräch. Da das Urteil selbst gesetzlich keiner Besprechung unterworfen werden darf, beschränken sich die Zeitungen auf sehr einfache Demonstrationen. Der Rappel schreibt: "Der Prinz Pierre Bonaparte ist freigesprochen. Wenn die republikanischen Blätter es allein ankündigten, so würde man natürlich glauben, sie verleumdeten das Kaiserreich. Aber man braucht nur die Zeitungen der Regierung zu lesen, und man wird sehen, dass das Kaiserreich es eingesteht. Die Bürger haben also in Zukunft nur noch Eins zu tun: sie müssen Revolver kaufen, sich vor den Prinzen hüten und sich selbst beschützen." Rom, 1. April 1870. [Unfehlbare Zündhölzchen.] Die Fabrikation von Schwefelhölzchen ist fast die einzige Industrie, die im Staate Sr. Heiligkeit gedeiht. Die feinste Gattung eines Fabrikats aus Viterbo trägt den Namen Flammiferi infallibili, unfehlbare Zündhölzchen; unfehlbar deshalb, weil sie beim ersten Anstriche sofort Feuer fangen sollen. Nun wollte es das Unglück, dass der Papst in seinem Zimmer eine Schachtel mit der verhängnisvollen Aufschrift erblickte. Er sei, heißt es, ganz außer sich gewesen, weil er die Sache für einen Hohn genommen habe; die Anwendung der Etikette wurde daraufhin von der römischen Polizei verboten. - Obwohl die Zündhölzer leider nicht halten, was sie versprechen, zeigt dies doch, in welch reizbarem Zustand der Papst sich gegenwärtig befindet. Osaka, 5. April 1870. [Eisenbahn.] Die letzten Nachrichten melden, dass bereits alle Vorkehrungen getroffen sind, um die ersten Eisenbahnen hier einzuführen. Die erste Linie soll Yeddo und Osaka, die alte und die neue Hauptstadt mit einander verbinden, und dann sollen Zweigbahnen von Yeddo nach Yokuhama und von Osaka nach Tjurnga gebaut werden. Die Bahnen werden Eigentum der japanesischen Regierung sein und von einer Anzahl englischer Ingenieure gebaut werden. Berlin, 7. April 1870. [Öffentliche Gesundheit.] Gegenstand der gestrigen 36. Sitzung des Norddeutschen Reichstages war die Frage der öffentlichen Gesundheit. Abg. Graf Münster führte aus: es handle sich darum, den Menschen reine Luft, reinen Boden, reines Wasser und unverfälschte Nahrung zu geben. Namentlich müssten die Nahrungsmittel untersucht und die Resultate veröffentlicht werden, damit die Leute beim Kaufen und Consum vorsichtig seien. Bern, 3. Juni 1870. [Die Gotthardbahn.] Nachdem berechtigte Hoffnung besteht, dass die Fragen betreffs der Subsidien der Bahn in Kürze geklärt werden, dürfte das große und kostspielige Werk wohl zu Stande kommen. Weiter im nächsten Kapitel: |
|
[Home] [Vor dem Konzil] [Konzil der Unfehlbarkeit] [Schluss der Debatte] [Nach dem Dogma: Krieg] [Pius IX. und Kirchenstaat] [Texte 1: Enzyklika Cuanta cura] [Texte 2: Syllabus errorum] [Texte 3: 245 Dogmen] [Koran vs. Katholizismus] [Impressum/Kontakt] |

