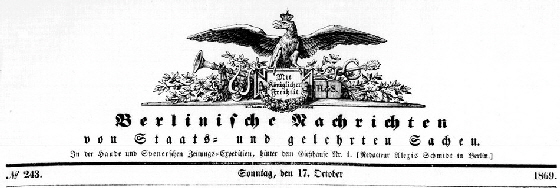|
Berlin, 19. Juli 1870. [Kriegserklärung.] Die am heutigen Tage mittags 1½ Uhr übergebene französische Kriegserklärung, die erste und einzige schriftliche Mitteilung, welche die Regierung in dieser ganzen Angelegenheit von der französischen erhalten hat, lautet wie folgt:
"Der unterzeichnete Geschäftsträger Frankreichs hat in Ausführung der Befehle, die er von seiner Regierung erhalten, folgende Mitteilung zur Kenntnis Sr. Exzellenz des Herrn Ministers der Auswärtigen Angelegenheiten Sr. Majestät des Königs von Preußen zu bringen: Die Regierung Sr. Majestät des Kaisers der Franzosen, indem sie den Plan, einen preußischen Prinzen auf den Thron von Spanien zu erheben, nur als ein gegen die territoriale Sicherheit Frankreichs gerichtetes Unternehmen betrachten kann, hat sich in die Notwendigkeit versetzt gefunden, von Sr. Majestät dem Könige von Preußen die Versicherung zu verlangen, dass eine solche Combination sich nicht mit seiner Zustimmung verwirklichen könnte. Da Se. Majestät der König von Preußen sich geweigert, diese Zusicherung zu erteilen, und im Gegenteil dem Botschafter Sr. Majestät des Kaisers der Franzosen bezeugt hat, dass er sich für diese Eventualität, wie für jede andere, die Möglichkeit vorzubehalten gedenke, die Umstände zu Rate zu ziehen, so hat die kaiserliche Regierung in dieser Erklärung des Königs einen Frankreich ebenso wie das allgemeine europäische Gleichgewicht bedrohenden Hintergedanken erblicken müssen. Diese Erklärung ist noch verschlimmert worden durch die den Cabinetten zugegangene Weigerung, den Botschafter des Kaisers zu empfangen und auf irgend eine neue Auseinandersetzung mit ihm einzugehen. In Folge dessen hat die französische Regierung die Verpflichtung zu haben geglaubt, unverzüglich für die Verteidigung ihrer Ehre und ihrer verletzten Interessen zu sorgen, und entschlossen, zu diesem Endzweck alle durch die ihr geschaffene Lage gebotenen Maßregeln zu ergreifen, betrachtet sie sich von jetzt an als im Kriegszustande mit Preußen.
Berlin, 19. Juli 1870"
Stuttgart, 20. Juli 1870. [Kriegsteilnahme.] Der französische Gesandte hat gestern hier die Bescheidung empfangen, dass Württemberg an dem Nationalkriege gegen Frankreich teilnehme. Die Aushändigung der Pässe an den Gesandten erfolgt ungesäumt.
München, 20. Juli 1870. [Kriegseintritt.] Graf Bray hat den königlich bayerischen Gesandten Baron v. Perglas angewiesen, dem norddeutschen Bundeskanzler v. Bismarck die Mitteilung zu machen, dass in Folge der Kriegserklärung Frankreichs an Preußen und des stattgehabten Angriffs der Franzosen auf deutsches Gebiet die königlich bayerische Regierung auf Grund des Allianzvertrages als Verbündeter Preußens in den Krieg gegen Frankreich gleich sämtlichen deutschen Regierungen eingetreten ist.
Paris, 23. Juli 1870. [Die Proclamation Napoleons.] Das Journal officiel veröffentlicht die Proclamation des Kaisers an das französische Volk. Dieselbe lautet, datiert vom 22. Juli:
Franzosen! Es gibt im Leben der Völker feierliche Augenblicke, wo die Ehre der Nation in gewaltiger Erregung sich als eine unwiderstehliche Macht erhebt, wo sie alle anderen Interessen beherrscht und allein und unmittelbar die Geschicke des Vaterlandes in die Hand nimmt. Eine dieser entscheidenden Stunden hat für Frankreich geschlagen.
Preußen, dem wir während des Krieges 1866 und seit demselben die versöhnlichsten Gesinnungen bezeugt hatten, hat von unserem guten Willen, unserer Langmut keine Notiz genommen. Fortstürmend auf dem Weg der Eroberungen hat es zu jedem Misstrauen Anlass gegeben, überall übertriebene Rüstungen notwendig gemacht und Europa in ein Heerlager verwandelt, wo Ungewissheit und die Furcht vor dem nächsten Tage herrschen.
Ein letzter Zwischenfall ist noch hinzugekommen. Gegenüber den neuen Anmaßungen Preußens haben sich unsere Einsprüche vernehmen lassen. Man hat ihrer gespottet und sie mit Bezeigungen des Hohnes beantwortet. Unser Land ist darüber von einer tiefen Erbitterung ergriffen worden, und alsbald hat sich der Ruf nach Krieg von einem Ende Frankreichs bis zum andern vernehmen lassen.
Wir führen den Krieg nicht gegen Deutschland, dessen Unabhängigkeit wir respektieren. Wir hegen den Wunsch, dass die Völker, welche die große germanische Nation ausmachen, in freier Weise über ihre Geschicke verfügen. Was uns betrifft, so verlangen wir einen Stand der Dinge, welcher unsere Sicherheit gewährleistet und die Zukunft sichert; wir wollen einen dauerhaften, auf die wahren Interessen der Völker begründeten Frieden erobern.
Franzosen! Ich bin im Begriff, mich an die Spitze dieser tapferen Armee zu stellen, welche von Pflichtgefühl und Vaterlandsliebe beseelt ist. Sie weiß, was sie wert ist, denn sie hat gesehen, wie in den vier Weltteilen sich der Sieg an ihre Schritte heftete. Ich führe meinen Sohn mit mir; ungeachtet seines jugendlichen Alters kennt er die Pflichten, welche sein Name ihm auferlegt; er ist stolz, teilnehmen zu dürfen an den Gefahren derjenigen, welche für das Vaterland kämpfen.
Gott segne unsere Anstrengungen! Ein großes Volk, das eine gerechte Sache verteidigt, ist unüberwindlich!
Napoleon
Paris, 28. Juli 1870. [Räumung Roms von den Franzosen.] Der Befehl zur Abberufung der französischen Soldaten aus Rom ist von Napoleon erteilt worden. Frankreich braucht alle seine Soldaten, und das römische Besatzungs-Corps muss vor dem 15. August in Frankreich sein. Der König von Italien wird den Schutz des Papstgebietes übernehmen. Der Papst hat übrigens keinen Aufschub der Maßregel verlangt.
Wien, 28. Juli 1870. [Aufhebung des österreichischen Concordates.] Die "Wiener Zeitung" veröffentlicht heute die folgende Note:
"Aus Anlass der Infallibilitäts-Erklärung des päpstlichen Stuhles haben in den bezüglichen Ministerien eingehende Beratungen stattgefunden. Dieselben haben zu dem Ergebnisse geführt, dass das mit Sr. Heiligkeit Papst Pius IX. am 18. August 1855 abgeschlossene Übereinkommen (Concordat) in Folge der neuesten Erklärung des Heil. Stuhles über die Machtvollkommenheit des Oberhauptes der katholischen Kirche nicht länger aufrechtzuerhalten und daher außer Wirksamkeit zu setzen sei."
Mainz, 2. August 1870. [Aufruf.] Der König hat folgenden Aufruf erlassen:
An die Armee! Ganz Deutschland steht einmütig in Waffen gegen einen Nachbarstaat, der uns überraschend und ohne Grund den Krieg erklärt hat. Es gilt die Verteidigung des bedrohten Vaterlandes, unserer Ehre, des eigenen Herdes. Ich übernehme heut das Commando über die gesamten Armeen und ziehe getrost in einen Kampf, den unsere Väter in gleicher Lage einst ruhmvoll bestanden. Mit mir blickt das ganze Vaterland vertrauensvoll auf euch. Gott der Herr wird mit unserer gerechten Sache sein!
Wilhelm.
Rom, 12. August 1870. [Die Verteidigung Roms.] Angesichts des Abzuges der französischen Schutztruppen aus Rom beeilt sich die päpstliche Regierung, das Mögliche zu ihrer Verteidigung zu tun. Der Waffenminister des Kirchenstaates hat 25.000 Fr. für die Wiederherstellung der Barricaden vor den Toren Roms ausgesetzt und beschlossen, sämtliche Truppenkörper, welche sich gegenwärtig in der Provinz aufhalten, in der Hauptstadt zu concentrieren.
Pont-a-Mousson, 19. August 1870. [Eingegangene Telegramme.] Gestern glänzender Sieg bei Gravelotte. Franzosen aus den stärksten hintereinander liegenden Positionen vertrieben und auf Metz zurückgeworfen, sind jetzt auf engen Bezirk um Metz eingeschränkt und von Paris gänzlich abgeschlossen, nachdem die Eisenbahn von Metz nach Thionville vom zwölften Corps besetzt worden. Verluste unserer Truppe stehen leider mit der Größe ihrer heldenmütigen Leistungen gegen die von ihnen gestürmten Stellungen der Franzosen im Verhältnis.
Berlin, 3. September 1870. [Kaiser Napoleon gefangengenommen.] Die erste Nachricht von der großen Entscheidung bei Sedan ist durch folgende Depesche hierher gelangt:
Varennes, 2. September, 1 Uhr 50 Nachmittags. An Minister Graf Lüneburg. Von 7 Uhr gestern früh bis 6 Uhr Abends Schlacht vor Sedan, in deren Folge Napoleon, mit 80.000 Franzosen in die Festung Sedan zurückgedrängt, sich dem König auf Gnade und Ungnade ergeben hat. Graf Reille, General-Adjutant des Kaisers, überbrachte dem König in meiner Gegenwart den Brief folgenden Inhalts: Da es ihm nicht gelungen, von einer Kugel getroffen zu werden, bleibe ihm nichts übrig, als Seiner Majestät seinen Degen zu Füßen zu legen. Bitte dies der Königin zu melden; komme eben vom Schlachtfelde.
gez. Hermann Graf Seherr
Paris, 4. September 1870. [Republik ausgerufen.] J. Favre brachte folgenden Antrag auf Absetzung des Kaisers ein:
Artikel 1. Louis Napoleon und seine Dynastie sind der Befugnisse, welche ihnen die Verfassung übertragen hat, für verlustig erklärt.
Artikel 2. Es wird eine Commission ernannt, welche die Aufgabe hat, die Verteidigung bis zum Äußersten fortzusetzen und den Feind zu vertreiben.
Artikel 3. General Trochu wird in seinen Functionen als General-Gouverneur von Paris bestätigt.
Unter heftigen Tumulten wurde die Absetzung verkündet und die Republik ausgerufen. Eine provisorische Regierung ist eingesetzt, welcher u.a. Trochu, Arago, Favre, Cremieux, Ferry, Gambetta und Rochefort angehören.
Florenz, 18. September 1870. [Der Einmarsch in den Kirchenstaat.] Am 11. September erteilte König Victor Emanuel den Befehl, dass seine Truppen in den Kirchenstaat einrückten. Sogleich erhob sich die Bevölkerung von Viterbo (im nördlichen Teil des Kirchenstaates) unter dem Ruf "Es lebe Italien"; Jubel und Demonstrationen gab es auch in Terracina, im Süden des Kirchenstaates. [Langfassung dieses Artikels siehe Kapitel “Pius IX. und Kirchenstaat”]
Lagny, 20. September 1870. [Paris eingeschlossen.] Ziel der letzten Tage war es, den Ring zu schließen, der Paris von aller Verbindung mit dem übrigen Lande abschneidet. Die Einschließung ist mit den heutigen militärischen Maßnahmen beendet; die Stadt ist isoliert, selbst ein Flüchten aus der Stadt ist nicht mehr möglich, ebenso jeder Zuzug abgeschnitten.
Rom, 20. September 1870. [Rom ist genommen!] Nach einer etwa fünfstündigen Beschießung war die erste Bresche eröffnet; die Infanterie des Generals Cosenz war zuerst in der Stadt. In der Straße Pia bis zum Quirinal herrschte ungeheurer Jubel, die Soldaten wurden mit Viva l'Italia, viva Roma capitale! begrüßt.
Berlin, 22. September 1870. [Die Unterwerfung der deutschen Bischöfe.] Am letzten Dienstag haben wir ein sehr merkwürdiges Schriftstück mitgeteilt: einen gemeinschaftlichen Hirtenbrief deutscher Bischöfe, in welchem dieselben ihre Unterwerfung unter die Glaubensdecrete des Römischen Concils ankündigen. Darin heißt es:
"Der Heilige Geist hat durch den Stellvertreter Christi und den mit ihm vereinigten Episcopat gesprochen und daher müssen Alle, Bischöfe, Priester und Gläubige, diese Entscheidungen als göttlich geoffenbarte Wahrheiten mit festem Glauben annehmen und sie mit freudigem Herzen erfassen und bekennen, wenn sie wirklich Glieder der Einen, heiligen, katholischen und apostolischen Kirche sein und bleiben wollen."
Sollen wir die Bischöfe daran erinnern, mit welchen Gründen sie die Lehre von der päpstlichen Unfehlbarkeit bekämpften? Dass sie selber ausgeführt haben: diese unerhörte Lehre hat keine Begründung in der Offenbarung. Sie steht im Widerspruch mit der katholischen Tradition. Die alte Kirche hat gerade das Gegenteil gelehrt; ein Papst Honorius ist verurteilt worden. Die Verfechter des Decrets stützen sich auf verstümmelte und gefälschte Urkunden. Das Concil ist in seiner octroyierten Geschäftsordnung von allen früheren Rechten und Gewohnheiten abgewichen; es stellte mit seiner Majorität der italienischen Bischöfe und der 200 Papierbischöfe in partibus infidelium eine absichtliche und scandalöse Fehlrepräsentation der wahren kirchlichen Mehrheitsverhältnisse dar.
Auf einmal sind alles dies nur noch "irrige Auffassungen, welche seit Monaten über das Concil verbreitet worden sind und die jetzt auch noch in unbefugter Weise an manchen Orten sich geltend zu machen suchen". Diese wankelmütigen, an ihre Pfründen sich klammernden Bischöfe sind wahrlich von allen guten Geistern verlassen, vom Heiligen Geiste gar nicht zu reden.
Rom, 7. October 1870. [Das Ende des Kirchenstaates.] Im Plebiscit vom 2. October haben von den 167.548 stimmberechtigten Einwohnern des Kirchenstaates 133.681 "für die Vereinigung mit dem Königreich Italien unter der monarchisch-constitutionellen Regierung des Königs Victor Emanuel II. und seiner Nachfolger" gestimmt, 1507 dagegen. Für den Papst ist es ein schwerer Schlag, dass nicht einmal 2 von hundert seiner früheren Untertanen ihm die Treue hielten. [Langfassung dieses Artikels siehe Kapitel “Pius IX. und Kirchenstaat”]
Madrid, 17. November 1870. [Königswahl.] Am gestrigen Tage, 7½ Uhr Abends, fand die feierliche Abstimmung zur Königswahl statt. Von den 345 Deputierten der Cortes nahmen 311 teil. Der Herzog von Aosta erhielt 191 Stimmen, außerdem 2 schon zuvor schriftlich abgegebene. Für die Föderativ-Republik waren 60 Stimmen, für den Herzog von Montpensier 27, für den Herzog de la Victoria 8, für den Prinzen Alfonso 2, für die Herzogin von Montpensier 1 Stimme. 17 Wahlzettel, von welchen 12 carlistischen Deputierten gehörten, waren unbeschrieben. Die dem Wahlgesetz entsprechende Majorität mmussten 173 Stimmen sein; daher ist der Herzog von Aosta von dem Präsidenten der constituierenden Cortes zum König proclamiert worden. Artilleriesalven verkündeten das Ereignis der Bevölkerung.
Rom, 24. November 1870. [Encyclica.] In der neuesten Encyclica Pius' IX. heißt es u.a.:
"Eine ungeheuerliche Freveltat ... können Wir hier nicht übergehen. Als ob nämlich Besitz und Rechte des apostolischen Stuhles ... durch einen Volksaufstand ... ihre Geltung verlieren könnten, suchte man ... jenen Spiegelfechter-Apparat einer Volksabstimmung hervor, der schon in den anderen Uns entrissenen Provinzen angewendet worden war ...
Wir erklären überdies ... dass Wir Uns in einer derartigen Gefangenschaft befinden, dass Wir Unser oberstes Hirtenamt sicher, leicht und frei durchaus nicht ausüben können.
... endlich ... erklären Wir laut und öffentlich, dass Wir ... keinem Vergleich ... beistimmen werden, der auf irgend eine Weise Unsere ... Rechte vernichtet oder mindert ...
Da aber Unsere Ermahnungen ... vergeblich waren, so erklären Wir ... dass alle Jene ... welche die feindliche ... Wegnahme ... irgend welcher Provinz Unseres Landes ... vollbracht oder daran Teil genommen ... dem großen Kirchenbann ... verfallen seien ...
Wir erklären auf die feierlichste Weise abermals ... dass es Unser ... Wille sei, Besitzungen und Rechte des heiligen Stuhles ungeschmälert ... zu erhalten und Unseren Nachfolgern zu überliefern ... und dass alle Handlungen der Feinde ... die ... geschehen sind und noch künftig geschehen werden, von Uns auch für jetzt und künftig verworfen, vernichtet und für ungültig erklärt werden. [Langfassung dieses Artikels siehe Kapitel “Pius IX. und Kirchenstaat”]
Weiter im nächsten Kapitel:
Pius IX. und der Kirchenstaat
|